Ab 31. Oktober 2020 bin ich frei von allen lokal- und regionalpolitischen Funktionen und allein gebetener und ungebetener Ratgeber; wer will, kann das auf meiner Website (schmitter.sifisu.org) lesen.
Auf der Grundlage meiner Analyse der Ergebnisse der Kommunalwahlen in NRW am 13. September 2020 wage ich eine Prognose für die nächsten Jahre und schlage Konsequenzen für die Arbeit der SPD vor Ort, in der Region und auf Bundesebene vor.
Ich weiß, dass ich mich in der Vergangenheit mit meinen Prognosen (auch) geirrt habe, aber ich weiß auch, dass es der SPD auf Landes- wie Bundesebene bis heute nicht gelungen ist, regierungsfähig zu werden. Das schmälert nicht die Leistungen der SPD-Minister in der CDU/SPD-Koalition unter der Bundeskanzlerin Merkel, aber reduziert die Wirkung für die Zweitstimmen der SPD bei der Bundestagswahl.
Ich bin – wie schon früher (auch schriftlich) geäußert – der Auffassung, dass die Praxis der differenzierten, am Kompromiss orientierten Ausarbeitung von Koalitionsverträgen durch die Spitzen der Parteien, die regieren wollen, nicht zwingend grundgesetzkonform ist. Unser Grundgesetz kennt keine „Koalitionsverträge“, sondern in Zukunft kann es ausreichend sein, dass nach einer Wahl die Parteien (inklusive der dann im Bundestag vertretenen Fraktionen dieser Parteien) eine verbindliche Vereinbarung treffen, eine Bundeskanzlerin/einen Bundeskanzler mit der notwendigen Kanzlermehrheit zu wählen. Diese gewählte Person bestimmt dann (natürlich auf Vorschlag der Koalitionsfraktionen) die Minister ihrer Regierung, die dann vom Bundespräsidenten ernannt werden.
Dieser Vorschlag, ich wiederhole es, stärkt die Arbeit und Verantwortung des Parlamentes (Bundestages). Denn dort werden Kompromisse ausgehandelt und Gesetze beschlossen (natürlich mit der im GG vorgeschriebenen Zustimmung des Bundesrates).
Zurück zur Möglichkeit der SPD, den Bundeskanzler/die Bundeskanzlerin vorzuschlagen und mit der notwendigen Kanzlermehrheit im Bundestag zu wählen. Das traditionelle Modell, die größte Fraktion (einer bisherigen „Volkspartei“) sucht sich einen sog. „Juniorpartner“ hat genau so ausgedient wie die „Notlösung“ einer „Großen Koalition“.
Die Parteien, konkret die SPD, sollte versuchen, rechtzeitig vor der nächsten Bundestagswahl, mögliche Kooperationen mit anderen Parteien zu diskutieren, diese Kooperationsangebote in den Parteigremien zu entscheiden und dann zu veröffentlichen, damit die Wählerinnen und Wähler wissen, was sie erwartet und welcher Partei sie (auf Grundlage des Programmes und der Personen) die Priorität geben.
Bisher „ziert“ sich die SPD, solche Kooperationen zu veröffentlichen, und hofft, als Einzelpartei eine ausreichende Mehrheit an Stimmen zu erhalten.
Das ist eine folgenschwere Illusion. Die Wählerinnen und Wähler müssen wissen, welche Kooperationen geplant sind.
Hinzu kommt – und das gilt für alle Wahlen –, dass die Zahl der sog. Stammwähler schrumpft (sie sterben aus, auch wenn sie älter werden – meine eigene Erfahrung). Ich schätze die Zahl heutzutage bei unter 10 %.
Weiterhin nimmt die Zahl der sog. Wechselwähler zu. Sie orientieren sich an wenigen aktuellen Problemlagen und den damit (medienmäßig) verbundenen „Leitpersonen“. Das gilt zunehmend auch für örtliche Kommunalwahlen, selbst wenn dort die Parteizugehörigkeit nicht immer entscheidend ist.
Bevor ich zur Analyse der vorvorgestrigen Kommunalwahl im Münsterland komme, will ich zur Situation auf Bundesebene vorweg sagen, dass ich zur Zeit keine Alternative zur Parteidoppelspitze und zum vorbestimmten Kanzlerkandidaten Olaf Scholz sehe. Die SPD muss zur Bundestagswahl 2021 konsequent an ihrem Personalvorschlag und der jetzigen Parteidoppelspitze festhalten und sie bestätigen; nur dann kann es gelingen, eindeutig über 20 % der Zweitstimmen zu erreichen.
Ich beginne meine Analyse so konkret wie möglich auf der untersten Ebene, dem Stimmbezirk 5 der Gemeinderatswahl Metelen. In diesem Stimmbezirk wurde vor Jahren Angelica Schwall-Düren zum ersten Mal direkt in den Gemeinderat gewählt. Das gelang auch mir (wir wohnten/wohnen im Stimmbezirk auf der Neustraße). Erst bei der Gemeinderatswahl 2014 unterlag ich der CDU-Kandidatin mit weniger als 10 Stimmen (bei Stimmverlusten des UWG-Kandidaten, die wahrscheinlich der CDU nutzten).
Am 13. September 2020 ergab sich im Stimmbezirk 5 der Gemeinde Metelen folgende Situation:
Von 567 Wahlberechtigten gaben 352 Wählerinnen und Wähler (ab 16 Jahren) ihre Stimme ab; das sind 62,08 % der Wahlberechtigten. 11 Stimmen waren ungültig; der CDU-Kandidat erhielt 104 Stimmen; die SPD-Genossin Birsen A. erhielt 97 Stimmen und der Grünen-Kandidat 106 Stimmen; der UWG-Kandidat abgeschlagen 34 Stimmen. Damit war der Kandidat der Grünen mit 2 Stimmen Vorsprung vor dem CDU-Bewerber und 9 Stimmen Vorsprung vor der SPD-Bewerberin direkt in den Gemeinderat gewählt. Bei 10 direkt (mit relativer Mehrheit) zu wählenden Mitgliedern blieb dies das einzige Direktmandat der Grünen; die SPD erhielt (im Stimmbezirk 4) ebenfalls ein Direktmandat mit 109 Stimmen; die anderen 8 Direktmandate gingen an die CDU (Stimmenanzahl von 180 Stimmen bis 109 Stimmen). Da nach unserem Kommunalwahlgesetz diese Stimmen doppelt gezählt werden (zur Verteilung der 20 Ratsmandate nach dem Verhältniswahlrecht), ergibt sich für den neuen Gemeinderat folgende Sitzverteilung: CDU 8 Sitze (180 bis 86 Stimmen je Stimmbezirk); SPD 5 Sitze (113 bis 36 Stimmen); Grüne 4 Sitze (107 bis 25 Stimmen); UWG 3 Sitze.
Für das Ergebnis im Stimmbezirk 5 ist zu bedenken: SPD-Bewerberin und der Grünen-Bewerber wohnen beide im Stimmbezirk; der Grüne ist „Poalbürger“; der Stimmbezirk wurde vor der Wahl nach dem Urteil des Landesverfassungsgerichtes um ca. 60 Wahlberechtigte vergrößert.
Weiterhin ist festzustellen: seit über 10 Jahren haben die Grünen in diesem Stimmbezirk keinerlei Aktivität mehr entwickelt (das gilt auch für die gesamte Gemeinde Metelen), das gilt auch für die bisherige CDU-Ratsfrau, während die SPD (ich als Sachkundiger Bürger im Schulausschuss und (ehemaliger) Vorsitzender des Fördervereins der Offenen Ganztagsgrundschule) vier- bis fünfmal im Jahr unsere Zeitschrift Kiebitz in alle Haushalte verteilt hat und ich vor der Wahl zweimal mit meiner „Nachfolgerin“ alle Straßen unseres Stimmbezirks (mit ihren Haushalten) „heimgesucht“ habe.
Ich erwähne diese Details, um aus diesem speziellen Wahlergebnis folgende Schlussfolgerungen zu ziehen:
(1) Das Engagement von Birsen und mir hat sich gelohnt, denn mit 10 weiteren Stimmen wäre sie direkt gewählt worden. Und in Bezug auf das Verhältniswahlergebnis (mit 97 Stimmen das drittbeste) hat sie dazu beigetragen, dass die SPD-Fraktion nur einen Sitz verloren hat und die CDU ihre absolute Mehrheit im Gemeinderat verloren hat (dabei muss die CDU-Stimme des Bürgermeisters – es gab keinen Gegenkandidaten – mit beachtet werden).
(2) Bei dem Wahlverhalten in diesem besonderen Stimmbezirk in einem Dorf mit 6.500 Einwohnern hat die traditionelle CDU-Bindung (im katholischen Münsterland) kaum noch wahlentscheidende Bedeutung, aber die Verankerung in der Nachbarschaft ist wichtig (und das gilt in diesem Fall sowohl für SPD und Grüne).
(3) Für junge Wählerinnen und Wähler (unter 20 Jahre) und Neubürgerinnen und Neubürger (so meine Vermutung für das Gebiet um ehemals Lohoffs Mühle) ist nicht so sehr die bisherige Leistung in der Kommunalpolitik entscheidend, sondern überregionale, landesweite (durch die Medien in jedes Haus übertragene) Tendenzen und Stimmungen schlagen (neben dem örtlichen Bekanntheitsgrad der Bewerberinnen und Bewerber) durch und beeinflussen das Wahlverhalten. Sonst ist der Wahlerfolg der Grünen (in diesem Fall mit 2 bis 10 Stimmen Mehrheit) m.E. nicht zu erklären.
Soweit meine Überlegungen vor Ort. Nun zur Kreisebene.
Meine (insgeheime) Prognose, dass bei der Landratswahl die Grünen-Kandidatin in die Stichwahl käme, lag eindeutig falsch; sie blieb bei unter 20 %. Und es ist kein Trost (auch für die Grünen nicht!), dass unser Kandidat Matthias (SPD) 0,22% Stimmen weniger erhielt. Aber ich blicke nicht zurück, sondern addiere 18,70 % und 18,92 % zusammen; das ergibt mehr als 35 %! Ein gemeinsamer Kandidat oder eine gemeinsame Kandidatin von SPD und Grünen (und vielleicht noch UWG; von den Linken ganz zu schweigen) wäre zumindest in die Stichwahl gekommen.
Nun ahne ich, wie meine Genossinnen und Genossen aufschreien: Mit diesen (konkreten) Grünen (oder Linken) war eine Kooperation nicht möglich! Geschenkt! Ich blicke in die Zukunft und wiederhole Ergebnisse meiner Analyse:
(1) Stammwählerverhalten stirbt aus (unter 10 % – trotz Ibbenbüren).
(2) Aktuelle bundesweite Themen und Tendenzen schlagen durch; selbst da, wo die Grünen keine Leistungen vorweisen können oder sich in der konkreten politischen Arbeit widersprüchlich verhalten haben.
(3) Nicht direkt parteigebundene Kandidatinnen und Kandidaten, jung und kompetent, haben eine Chance, wenn sie von einem Mehrparteienbündnis unterstützt werden (siehe Bürgermeisterin in Coesfeld, einer ehemals tiefschwarzen Stadt, in der ich über 30 Jahre gearbeitet habe).
Also ziehe ich eine Konsequenz: sowohl vor Ort, wie regional, wie landesweit prognostiziere ich:
Mehrheiten und Direktmandate wird es in Zukunft nur noch in Kooperation zwischen SPD und Grünen (und gegebenenfalls Linken und UWG) geben.
Um Kooperation zu erreichen, muss zu diesem Ziel in den Fraktionen und in Zusammenarbeit mit anderen interessierten Fraktionen ab sofort intensiv gearbeitet werden. Animositäten sind in ihrer Wirksamkeit abzubauen.
Es ist doch ein Witz, dass in der Bundesrepublik zunehmend CDU/CSU und Grüne kooperieren, aber die SPD an der Illusion festhält, die einzige Volkspartei (links von der CDU/CSU) zu sein.
Hinzu kommt, dass wir endlich aus den Veränderungen in unserer Gesellschaft (Zerfall der sog. Mittelschichten, Veränderungen der Arbeitsgesellschaft, Klimaveränderung, weltweite Migrationsbewegungen,
Verschärfung des Gegensatzes von Armut und Reichtum, Gefährdung der Mitbestimmung, der Kompromissfähigkeit und der Sicherung der Grundrechte, auch für Minderheiten in den und durch die parlamentarischen Demokratien, Mangel an Aufklärung und Selbstbestimmung in den bisher relevanten Institutionen wie z.B. Kirchen und Gewerkschaften) lernen und nachhaltige Konsequenzen ziehen.

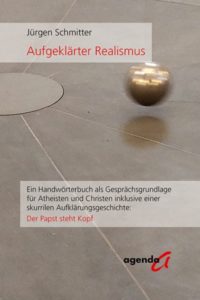
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.